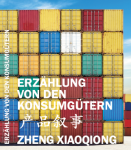
„Erzählung von den Konsumgütern“ – der Band heißt, wie sein erstes Gedicht, Erzählung; Fiktion für diejenigen, die die Herkunft übervoller Warenregale nicht hinterfragen, aber auch Einladung an all jene, die lieber keine Gedichte lesen. Das ist keine Lyrik aus dem „fernen“ China, die Gedichte gehen uns unmittelbar an, weil es unsere globalisierte Welt ist, die da beschrieben wird. Zheng Xiaoqiong, 1980 in Sichuan geboren, ging 2001 als Wanderarbeiterin nach Dongguan, wo ihre ersten Gedichte entstanden, wo „sie eine Freifläche aus ihrem Körper [holt], in der sie Gesundheitsschäden und Wut vergräbt, in die sie helle Wörter pflanzt […]“ (S.65)
Ihr erster, viel beachteter Gedichtband „Das Buch der Arbeiterinnen“ (女工记) gab den bis dahin anonym gebliebenen Wanderarbeiterinnen eine Stimme. Als sie 2007 überraschend den Liqun-Lyrikpreis erhielt, wuchs ihre Popularität sprunghaft. Diese Gedichte aus den Warenfabriken, die Portraits der Wanderarbeiterinnen, wie sie selbst eine war, machten sie zur Wortführerin einer ganzen Poesierichtung. Inzwischen lebt sie als freie Autorin und Mitherausgeberin eines Literaturmagazins und sitzt „versunken in einer Stadt im Süden und [schreibt] die Strophen und Balladen des Industriezeitalters.“ (S.23)
Die vorliegende Auswahl aus dem Gesamtwerk ist Zheng Xiaoqiongs erste Buchveröffentlichung auf Deutsch. Sie wurde von Christian Filips zusammengestellt und von und mit den Dichterinnen und Sinologinnen Sara Landa, Maja Linnemann, Eva Schestag und Lea Schneider übersetzt.
Einige der Gedichte erschienen bereits 2016 auf Deutsch in der von Lea Schneider zusammengestellten und übersetzten Anthologie neuer Lyrik aus der Volksrepublik, „Chinabox“, 2018 war Zheng Xiaoqiong zu Gast beim Poesiefestival und 2023 auf der Poetica 8, „Das chorische Ich. Writing in the name of …“, kuratiert von Christian Filips, dem Herausgeber des vorliegenden Bandes. Zu hören ist sie übrigens auf www.lyrikline.org, ein besonderes Erlebnis, da sie Rhythmus und Tempo variierend, die Kraft, Unmittelbarkeit und selbst Zartheit der Gedichte, nicht zuletzt durch ihren weichen Sichuan-Dialekt, auch jenseits des Verstehens der Sprache, spürbar macht.
Die „Stacheln [der Sprache] sind aufgestellt und stechen in dieses weiche Zeitalter“ (S.17). Manchmal stechen sie auch in meinen Lesefluss, ich stoße mich an Worten wie „Venusse“ und daran, dass in der Werkstatt geschleift und nicht geschliffen wird. Zheng Xiaoqiong verwendet wiederholt den Begriff der Zeit und des Zeitalters als etwas Vorübergehendes, Veränderliches und damit letztlich den Leser ob der beschriebenen Düsternis beinahe Tröstendes. Wandlung und Wiedergeburt: „Wenn die Epoche mich als Ausschussware deklariert,/ dann werde ich ins Feuer zurückkehren, mich in eine Form pressen, in spitze Nägel zerlegen und sie in die Wände der Epoche schlagen“, heißt es im Gedicht „Zum Abriss freigegeben“ (S.21). Aber die Möglichkeit einer Veränderung sieht sie nicht.
Sie beschreibt den Alltag der unteren sozialen Schichten, der Arbeiterinnen, der Abgehängten, schildert Orte ihres Alltags in stakkatoartigen Aufzählungen, zwischen Ohnmacht und Aufbegehren feststeckend, in wiederkehrenden Bildern, beschreibt „das 21. Jahrhundert,/ diese staubgraue Maschinerie, aus der gefällte Litschiwälder/ herabstürzen […]“. Leider fehlt dieses Klappentextgedicht in Gänze.
Im letzten Teil „Fußgänger-Himmelsbrücke“ verdichtet sie Gehörtes, Gesehenes, Gelesenes zu einem Crescendo. Zheng Xiaoqiongs Poesie ist Aufschrei, sie deckt auf und klagt an, sie wünscht sich, „dass mehr Schreibende ihre Arbeit mit dem Kampf der Schwachen verbinden, mit den Machtlosen, deren Stimmen nicht hörbar sind.“ (S.174) Ihre Gedichte knüpfen an Traditionen der Arbeiterliteratur, führen zu den Schmuddelecken, sie erzählt von einer unterrepräsentierten, von vielen absichtlich übersehenen Seite unseres 21. Jahrhunderts. Unbedingt lesenswert! Denn: „Alle haben ein Recht auf Gedichte“ wie die Autorin in einem Interview im besprochenen Band erklärt. Allerdings vermisse ich Angaben zu den Quellen: Wann und wo wurden die Originale veröffentlicht? Wurden sie es überhaupt? Diese Information hätte dem Buch unbedingt gutgetan und wurde nun auf der Website des Verlags nachgereicht.
Zheng Xiaoqiong: Erzählung von den Konsumgütern
Gedichte, aus dem Chinesischen übersetzt von Sara Landa, Maja Linnemann, Eva Schestag, Lea Schneider und Christian Filips (Hrsg.), zweisprachige Ausgabe Chinesisch und Deutsch,
Reihe Poesie Dekolonie, Bd. 3, Engeler Verlage, Schupfart und Berlin 2025.
